
Die Unterrichtung zum
Politiker/-innen müssen sich intensiver mit den Analysen beschäftigen
Die Bundesregierung bemängelt in der Unterrichtung von Mai 2023, dass die Kenntnis der einzelnen Risikoanalysen in Deutschland „im politischen Raum nicht weit verbreitet“ waren. Das ist ein Punkt, der sich dringend ändern muss. Den Beweis lieferten die Jahre 2020, 2021 und 2022. So lag in Deutschland bereits seit dem Jahr 2012 eine Risikoanalyse für eine „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ vor. Sie zeigt erhebliche Parallelen mit der durch das Coronavirus verursachte Pandemie, wurde aber bei der Einleitung der ersten Schutzmaßnahmen durch die Politiker/-innen nicht ausreichend beachtet. Die Gründe dafür wurden bereits in der Studie „RiskPol“ untersucht. Sie bestehen beispielsweise in Unklarheiten bei den Regelungen der Zuständigkeit und der mangelhaften Publikation der Risikoanalysen zum Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz sowie Defiziten der in den Risikoanalysen vorgeschlagenen Maßnahmen. Als Resultat wurde unter anderem die verstärkte Arbeit mit den kurzen „Steckbriefen“ empfohlen, die von Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (kurz BBK) zu einigen möglichen Szenarien bereits erarbeitet wurden.
Effizienter Katastrophenschutz erfordert eine optimierte Koordinierung
In Deutschland ist der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nicht nur eine Aufgabe der Bundesregierung. Auch die Länder bis hin zu den Kreisen und einzelnen Kommunen sind daran beteiligt. Das beginnt bei der zusätzlichen Erstellung regionaler Risikoanalysen und setzt sich über Stresstests und daraus abgeleiteten Maßnahmekatalogen fort. Zudem müssen auf den unteren Ebenen genau wie auf Bundesebene regelmäßig Soll-Ist-Abgleiche durchgeführt werden. An dieser Stelle bemängelt die Unterrichtung der Bundesregierung Mängel bei der Meldung und Erfassung sowie fehlende Konzepte zur Priorisierung bei Versorgungsengpässen.
Auch die Kommunikation zwischen den Beteiligten am Katastrophen- und Bevölkerungsschutz Beteiligten bedarf einer dringenden Verbesserung. Welche Folgen Mängel an dieser Stelle haben können, hat die Flutkatastrophe 2021 sehr eindrucksvoll gezeigt. In diese Kommunikation müssen auch die Betreiber/-innen kritischer Infrastrukturen (beispielsweise Krankenhäuser, Energie- und Wasserversorger) einbezogen werden.
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz ist nicht nur eine nationale Aufgabe
Die mangelhafte Resilienz (Widerstandskraft) gegenüber Großereignissen in Deutschland hat bereits zu ersten politischen Entscheidungen geführt. Ein Beispiel ist die neue Resilienzstrategie, die in der Bundesrepublik seit Juli 2022 gilt. Auch auf europäischer Ebene gab es schon erste Anpassungen. Sie fanden im Sommer 2020 mit Blick auf die bereits damals absehbaren Folgen der Coronapandemie statt und gipfelten in der Vorlage der CER-RL (Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen), die allerdings erst zwei Jahre später verabschiedet wurde.
Auf NATO-Ebene wurde in mehreren Schritten reagiert. Dazu gehören beispielsweise das Strategiepapier „NATO 2030“ und die „Terms of Reference“. Der Beginn des Ukrainekriegs sorgte zudem für die Einrichtung eines „Resilience Committees“ der NATO sowie die Verpflichtung aller NATO-Staaten zur Einsetzung eines nationalen Resilienzbeauftragten. In Deutschland wurde für diese Aufgabe die in Kiel geborene Politik- und Gesellschaftswissenschaftlerin Juliane Seifert ausgewählt.
Die Notwendigkeit zur internationalen Kooperation beim Katastrophen- und Zivilschutz hat sich durch den Ukrainekrieg massiv verstärkt. Der Zivilschutz ist dadurch genau wie die militärische Verteidigungsbereitschaft in den Fokus der politischen und organisatorischen Entscheidungen gerückt. Infolge der Annektierung der Krim durch Russland wurde in Deutschland deshalb das Konzept Zivile Verteidigung nach mehr als zwei Jahrzehnten im Jahr 2016 überarbeitet. Eine weitere Überarbeitung als Resultat der aktuellen Risikoanalyse Katastrophen- und Bevölkerungsschutz soll noch im Jahr 2023 erfolgen.
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6300

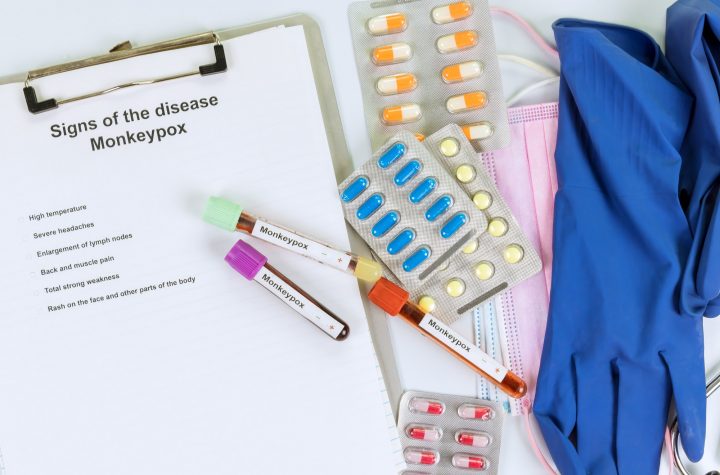



Weitere Meldungen
Joe Biden trifft härteste Entscheidung seines Lebens
Präsidentschaftswahl in den USA: Joe Biden fällt für ein paar Tage aus
Europawahl 2024 zeigt sehr gefährliche Tendenzen