
Inzwischen haben die astronomischen Beobachtungsstationen in unserem Sonnensystem knapp 1,39 Millionen Asteroiden entdeckt. Dazu gehört auch der
Welches Risikopotenzial weist der Asteroid 2024 YR4 auf?
Unmittelbar nach der Entdeckung wurden auch die anderen Frühwarnsysteme der ESA (European Space Agency) mit den Daten des neu entdeckten Himmelskörpers gefüttert. Dazu zählt auch das „Aegis“-System der ESA. Schnell lieferten die Berechnungen einen Hinweis darauf, dass ein gewisses Risiko für eine direkte Kollision mit der Erde besteht. Zeitweise wurde die Wahrscheinlichkeit für einen Aufprall mit bis zu 2,8 Prozent eingeschätzt. Mittlerweile hat das Planetary Defence Office (Büro für planetarische Verteidigung) der Europäischen Weltraumorganisation diese Wahrscheinlichkeit auf 0,001 Prozent reduziert. Das heißt, der rund 40 x 100 Meter große Asteroid 2024 YR4 wird die Erde zwar mehrfach passieren, aber nach dem aktuellen Wissensstand nicht unmittelbar treffen. Die Zeitpunkte der erdnächsten Passagen wurden für den Dezember 2032, den Dezember 2039 und Dezember 2047 berechnet.
Wie wird das Gefahrenpotenzial von Asteroiden eingestuft?
Das Hauptinstrument zur Einstufung des Risikopotenzials ist die Torino-Hazard-Skala. Sie wurde 1999 entwickelt und durch die Internationale Astronomische Union (kurz IAU) zur Anwendung empfohlen. Sie arbeitet mit einer Skala von 0 bis 10 und nutzt ergänzend farbige Markierungen. Die Stufen 8 bis 10 gehören zur Rotzone, der als sicher geltende Kollisionen zugeordnet werden. Die Stufen 5 bis 7 (Orangezone) markieren nahe Vorbeiflüge, bei denen Kollisionen so wahrscheinlich sind, dass die Himmelskörper einer intensiven Überwachung bedürfen und auch auf der Erde eine Notfallplanung in Kraft gesetzt werden muss. In der Grünzone (Stufe 1) finden sich bei der Torino-Hazard-Skala Himmelskörper, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Kollision nahe oder gleich Null ist. Die Gelbzone (Stufen 2 bis 4) enthält Himmelskörper, bei denen anfänglich ein minimales Kollisionsrisiko eingeschätzt wird, bei denen aber davon auszugehen ist, dass sie nach genaueren Beobachtungen und Berechnungen in die Grünzone zurückgestuft werden können.
Quelle: ESA
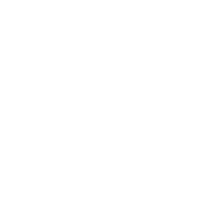

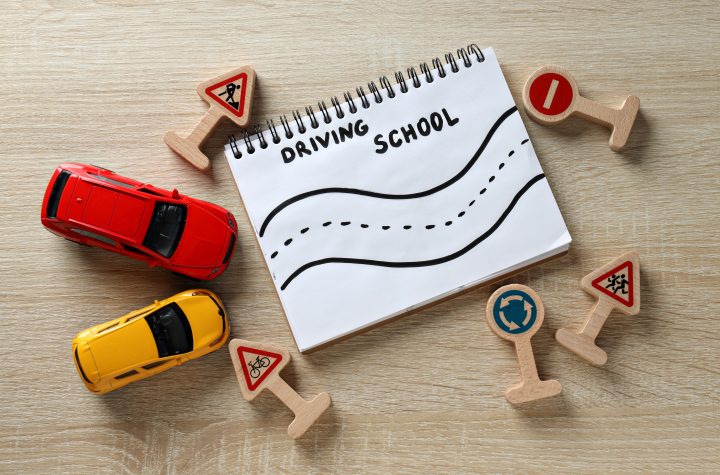


Weitere Meldungen
MetOp-SGA1: Mehr Daten für europäische Wetterdienste
Auf Erde treffender Sonnensturm: Stärke, Trend und Auswirkungen
Geplanter Wechsel der ISS-Besatzung musste erneut verschoben werden