
Das Copernicus-Programm wurde als gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Weltraumorganisation ESA im Jahr 1998 geschaffen. Seit 2014 gibt es ein eigenes Beobachtungsnetz, das auch für die Erhebung von Klimadaten genutzt wird. Die neuesten Auswertungen zeigen, dass
2024 überschreitet wahrscheinlich die 1,5-Grad-Grenze
Klimaschutzabkommen zielen darauf ab, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Aktuell sieht es so aus, als wäre dieser Grenzwert nicht zu halten, denn für das gesamte Jahr 2024 liegt der tatsächliche Temperaturüberschuss bereits bei 1,55 Grad Celsius. Bei einer separaten Betrachtung des Monats Oktober 2024 präsentiert sich sogar ein Temperaturüberschuss von 1,65 Grad Celsius. Er setzte eine ganze Reihe von Monaten fort, in denen der vereinbarte Grenzwert von maximal 1,5 Grad überschritten wurde. Eine Reihe von Klimaforschern führen das auf einen starken El Niño zurück, der unter anderem für großflächige Waldbrände sorgte. Dadurch fallen nicht nur Wälder als Temperatur- und Feuchtigkeitspuffer weg, sondern es entstehen dunkle Flächen, die mehr langwellige Wärmestrahlen der Sonne reflektieren als Wald- und Buschflächen. Auch der Vergleich der Temperaturen im Jahr 2024 mit der zeit von 1991 bis 2020 fällt katastrophal aus. Der Monat Oktober brachte um 0,71 Grad Celsius höhere Werte und die letzten zwölf Monate (November 2023 bis Oktober 2024) weisen sogar ein Plus von 0.74 Grad auf. Den Rekord als das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen könnten nur weltweite Durchschnittstemperaturen um den Gefrierpunkt in Gefahr bringen. Das gilt unter Klimaforschern als ausgeschlossen.
Ozeantemperaturen und Meereis: Wie sieht die Bilanz für 2024 bisher aus?
Die Oberflächentemperaturen der Ozeane zwischen dem 60. Breitengrad Nord und dem 60. Breitengrad Süd lagen im Oktober 2024 bei 20,68 Grad Celsius. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen und wird derzeit nur vom Oktober 2023 mit 20,78 Grad übertroffen. Es muss also auch nicht wundern, dass die Menge des arktischen Meereises derzeit unter dem langjährigen Durchschnitt liegt.
Aktuell geht jedoch der Trend im Zentralpazifik und Ostpazifik in Äquatornähe zu unterdurchschnittlichen Oberflächentemperaturen. Das ist in der Regel ein Anzeichen dafür, dass ein Jahr mit einem La Niña-Wetterphänomen bevorstehen könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch, weil es sich üblicherweise an einen El Niño anschließt.
Quelle: Copernicus
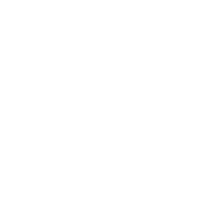




Weitere Meldungen
Weihnachten 2025: Zahlreiche Menschen im Los Angeles County evakuiert
Forschungsschiff „Polarstern“ erneut auf dem Weg in die Antarktis
Klimaphänomene: Temporäre Seen in Wüstenlandschaften