
Die Idee eines
Warum ein Megafonds?
Befürworter setzen auf Skalierung und Einfachheit. Ein großer Treuhandfonds mit klaren Kriterien kann Mittel von Staaten, Entwicklungsbanken und privaten Investoren bündeln. Er würde Zahlungen an Länder, Regionen und Gemeinden leisten, wenn nachweislich die Entwaldung sinkt und Kohlenstoff gespeichert bleibt. Vorbilder dafür existieren bereits. Der Amazonasfonds in Brasilien finanziert seit Jahren Projekte, die LEAF Coalition bündelt Abnahmen von hochwertigen Emissionsminderungen im großen Maßstab. Ein TFFF könnte solche Ansätze integrieren und langfristig planbar machen.
Wie das Geld wirken soll
Zentral sind ergebnisbasierte Zahlungen auf Basis nationaler oder regionaler Referenzlinien, robuste Messungen, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) sowie der Schutz vor Verlagerungseffekten. Ergänzend braucht es Investitionen in Rechtsdurchsetzung, Kataster, die bestehenden Landrechte indigener Völker, nachhaltige Lieferketten und produktive Alternativen zur Rodung. Ein TFFF könnte hierfür geeignete Mischfinanzierungen bereitstellen, beispielsweise Garantien, Erstverlusttranchen und zinsgünstige Kredite für Blended Finance Modelle.
Lehren aus bestehenden Programmen
Internationale Abmachungen aus der Vergangenheit liefern Erkenntnisse. Die Glasgow-Erklärung von 2021 versprach Milliarden für Wälder. Das globale Biodiversitätsabkommen setzt einen 30-prozentigen Schutz bis 2030. Gleichzeitig zeigen praktische Erfahrungen, dass Geld allein nicht reicht. Erfolgreiche Programme koppeln Zahlungen an transparente Governance, die unabhängige Erhebung von Daten und die Beteiligung lokaler Gemeinschaften. Schuldenerleichterungen beim Naturschutz können fiskalischen Spielraum schaffen, müssen aber auf Qualität und zusätzliche Wirkung geprüft werden.
Integrität, Preis und Nachfrage
Damit TFFF-Märkte nicht verwässern, braucht es hohe Standards. Dazu gehören großräumige, staatlich verankerte Ansätze, strenge Permanenzregeln, klare Eigentums- und Nutzungsrechte sowie öffentlich zugängliche Satellitendaten. Ein verlässlicher Mindestpreis pro vermiedener Tonne CO2 kann Investitionen anreizen und langfristige Verträge ermöglichen. Das Prinzip lautet: Geld gegen Entwaldung. Unternehmen finden so hochwertige Kompensationsmöglichkeiten für ihre Emissionen und Staaten erhalten Mittel für einen soliden Schutz.
Risiken und Kontrollmechanismen
Kritisch sind Doppelzählungen, soziale Konflikte und politische Rückschritte. Abhilfe schaffen unabhängige Aufsichtsgremien, Klagerechte für Betroffene, Leistungsreserven (sogenannte Buffer-Pools) sowie Auszahlungsstopps bei Regelverstößen. Entscheidend bleibt, der Fonds muss zusätzliche Wirkung schaffen und nicht bestehende Verpflichtungen umetikettieren.
Quellen: IPCC: Climate Change and Land: an IPCC special report; World Resources Institute: What Is the LEAF Coalition and Why Does It Matter?; Paulson Institute / The Nature Conservancy / Cornell Atkinson: Financing Nature: Closing the Global Biodiversity Financing Gap; Reuters: Brazil reactivates Amazon Fund as Lula takes office; UK Government (COP26): Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use
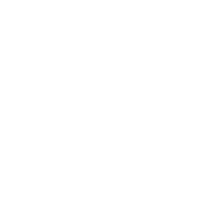
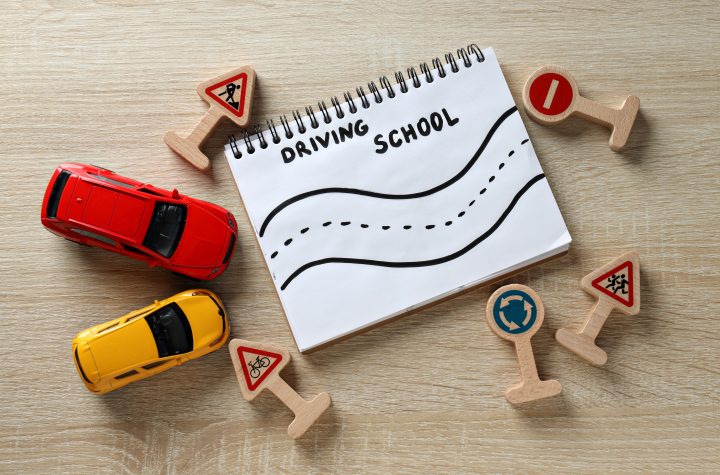



Weitere Meldungen
Naturschutz versus wirtschaftliche Interessen: Schwaben aktuelles Negativbeispiel
Tierschutz der Superlative: Wallis Annenberg Wildlife Crossing
Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe: Verkauf & Anwendung von Elipris gestoppt