
Der
Wie hängen die Kohletagebaue und die Wassermenge in der Spree zusammen?
Die Spree wird aus drei Quellen gespeist. Sie befinden sich in Ebersbach, in Neugersdorf und an den Flanken des Kottmar. Zusammen mit den kleinen Zuflüssen würde sie auf natürliche Weise keinesfalls das Volumen erreichen, dass sie derzeit vor den Toren des Spreewalds und der Metropole Berlin hat. In den 1980er Jahren wurden pro Minute rund 900 Kubikmeter Wasser aus dem Kohlebergbau in der Lausitz eingeleitet. Aktuell sind es noch rund 330 Kubikmeter pro Minute. Dabei handelt es sich um Grundwasser, das in die Tagebaue eindringt und abgepumpt werden muss. Noch können damit in Normalzeiten rund 50 Prozent und in Trockenzeiten bis zu 75 Prozent der Durchflussmenge in der Spree gesichert werden. Sie fallen spätestens ab 2038 weg.
Das Wasserproblem durch den Kohleausstieg ist wesentlich größer
Unmittelbar nach der Schließung der Kohletagebaue wird der Spree nicht nur das von dort eingeleitete Grundwasser fehlen. Das Defizit in der Wasserführung erhöht sich zusätzlich durch die Notwendigkeit, den künstlich abgesenkten Grundwasserspiegel wieder auf ein normales Niveau zu bringen, um nachhaltig Geländeeinbrüche durch nicht aufgefüllte Hohlräume zu verhindern. Solche Hohlräume bilden sich durch die Austrocknung des Bodens durch die Absenkung des Grundwasserspiegels. Allein dafür die Tagebaubereiche der LEAG werden zeitnah rund 3,2 Milliarden Kubikmeter Wasser benötigt. Weitere 1,9 Milliarden Kubikmeter Wasser sind nach der vom Umweltbundesamt vorgestellten Studie erforderlich, um die Tagebaurestlöcher im Rahmen der Rekultivierung zu fluten. Später muss ihr Wasserstand stabil gehalten werden. Das heißt, sie benötigen durch die großen Verdunstungsflächen zusätzliches Wasser. Dadurch fehlen der Spree noch einmal knapp 80 Kubikmeter Wasser pro Minute.
Wie soll das Wasserproblem gelöst werden?
Nach den aktuellen Überlegungen soll der Elbe im Oberlauf Wasser entnommen und zur Spree geleitet werden. Dafür wäre einerseits ein teures Tunnelsystem notwendig. Andererseits präsentiert sich auch an der Elbe ein wenig erfreulicher Trend. So wurde der langjährige mittlere Wasserstand am Pegel Riesa noch bis 2017 mit 2,70 Metern angegeben. Inzwischen gibt das Landesumweltamt Sachsen den mittleren Pegel lediglich noch mit 2,12 Metern an. In Dresden lag der Pegel beim letzten Rekordniedrigwasser im August 2028 gerade einmal noch bei 60 Zentimetern und verursachte eine komplette Einstellung der Schifffahrt. Deshalb stellt sich die Frage, ob man tatsächlich mehrere Hundert Millionen Euro für eine Tunnelverbindung zur Spree ausgeben oder sich nicht besser nach anderen Lösungen umschauen sollte.
Quelle: Umweltbundesamt
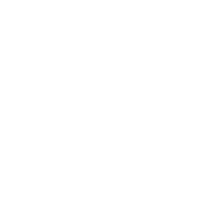




Weitere Meldungen
Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft durch viele Aspekte belastet
Jubiläum bei der Westfalenhalle in Dortmund
Das Oligopol in der deutschen Lebensmittelbranche und dessen Folgen